Das Verschlucken bereitet vielen Eltern, vor allem von Kleinkindern sehr viel Angst. Oft ist der Schreck sehr groß, wenn das Kind plötzlich zu Husten und Würgen beginnt. Hier ist es wichtig rechtzeitig und richtig zu handeln.
Doch wie kommt es eigentlich dazu, dass gerade Kleinkinder sich leicht verschlucken können? Dazu sollten wir uns die Anatomie und Physiologie der Atemwege beim Säugling und Kleinkind näher anschauen.
Beim Einatmen gelangt die Luft durch Nase und Mund in den Rachen und anschließend durch den Kehlkopf in die Lunge, wo der sogenannte Gasaustausch stattfindet. Ebenso gelangen Nahrung und Flüssigkeit durch den Rachen in die Speiseröhre und von dort aus weiter in den Magen. Aufgabe des Kehlkopfes bzw. Kehlkopfdeckels ist es, beim Schluckvorgang die Atemwege zu verschließen, damit die Nahrung in die Speiseröhre und nicht in die Luftröhre gelangt.
Beim Verschlucken kommt es dazu, dass ein Fremdkörper z.B ein Stück Erdnuss nicht in die Speiseröhre gelangt, sondern meistens in den oberen Atemwegen stecken bleibt und dadurch die Atemwege verlegt. Somit kann keine Luft mehr eingeatmet werden und es kommt zur plötzlichen Atemnot. Häufig ist diese durch ein energisches Husten und Würgen gekennzeichnet.
Weist Ihr Kind derartige Symptome auf und Sie haben die Vermutung, dass Ihr Kind sich Verschluckt hat, dann müssen Sie sofort handeln und den Notruf 112 wählen!

1. Husten fördern: Fordern Sie Ihr Kind zum Husten auf oder ermutigen Sie es weiter zu husten. Dies kann dazu beitragen, dass der Fremdkörper sich selbstständig löst und abgehustet wird.
2. Rückenschläge: Wenn sich die Situation nicht verbessert, schlagen Sie mit der flachen Hand fünfmal auf den Rücken des Kindes zwischen die Schulterblätter. Bei Kleinkindern und Babys ist es ratsam, sie mit dem Gesicht nach unten über den Oberschenkel zu legen und mit der anderen Hand am Brustkorb zu fixieren.
3. Heimlich-Manöver: Wenn auch das keine Besserung bringt, führen Sie bei einem Kleinkind das Heimlich-Manöver durch, indem Sie fünf Oberbauchkompressionen durchführen, um einen künstlichen Husten zu erzeugen und den Fremdkörper auszustoßen. Bei einem Baby (bis zum 1. Lebensjahr) sollten fünf Brustkorbkompressionen durchgeführt werden.
4. Abwechselnd wiederholen: Wiederholen Sie diese Maßnahmen abwechselnd, bis der Fremdkörper entfernt ist oder der Rettungsdienst eintrifft. Wenn sich der Zustand des Kindes verschlechtert, rufen Sie erneut die Rettungsleitstelle unter der 112 an und folgen Sie den Anweisungen des Disponenten.
Wichtig: Selbst wenn der Fremdkörper nach den Maßnahmen ausgestoßen wurde, muss das Kind ärztlich untersucht werden und der Notruf 112 getätigt werden. Es ist entscheidend, sicherzustellen, dass keine weiteren Verletzungen vorliegen und das Kind in Sicherheit ist.
„Unser Tipp: Laden Sie sich unser kostenloses Handout „Lebensrettende Sofortmaßnahmen bei Kindern und Babys“ von unserer Website herunter und hängen es an einen gut zugänglichen Ort, z. B. den Kühlschrank, um im Notfall die wichtigsten Maßnahmen, wie z. B. das Verschlucken bei Kindern, griffbereit zu haben.“
Haftungsausschluss: Wir weisen darauf hin, dass der Blogbeitrag lediglich der allgemeinen Information dient und keinen ärztlichen Rat und keinen Therapievorschlag für den konkreten Einzelfall ersetzt. Der Blogbeitrag ersetzt weder eine ärztliche Diagnose, medizinische Beratung oder Behandlung.
Bei Beschwerden und Symptomen empfehlen wir, Ihren Hausarzt, Facharzt bzw. Kinderarzt zu kontaktieren oder wählen den Notruf 112.
Unsere Leistungen

Erste-Hilfe Hörbuch
- Erste Hilfe am Baby auditiv lernen
- Wissen im Alltag aneignen

Erste-Hilfe vor Ort
- Vor Ort im Dialog lernen
- Beantwortung deiner Fragen vor Ort
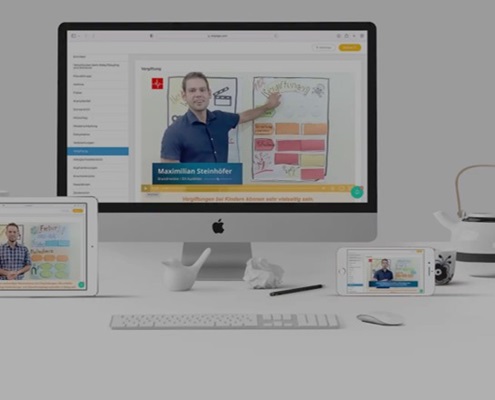
Erste-Hilfe online
- Onlinekurs mit 24 Lektionen
- Beantwortung deiner Fragen via Chat

Gutscheine
- Wissen an Eltern zur Geburt verschenken

Einschlafhilfe
- Dieses Hörspiel begleitet Kinder leichter in den Schlaf
Newsletter
- Informiert bleiben zu Notfällen bei Babys und Kindern

